- Informationen
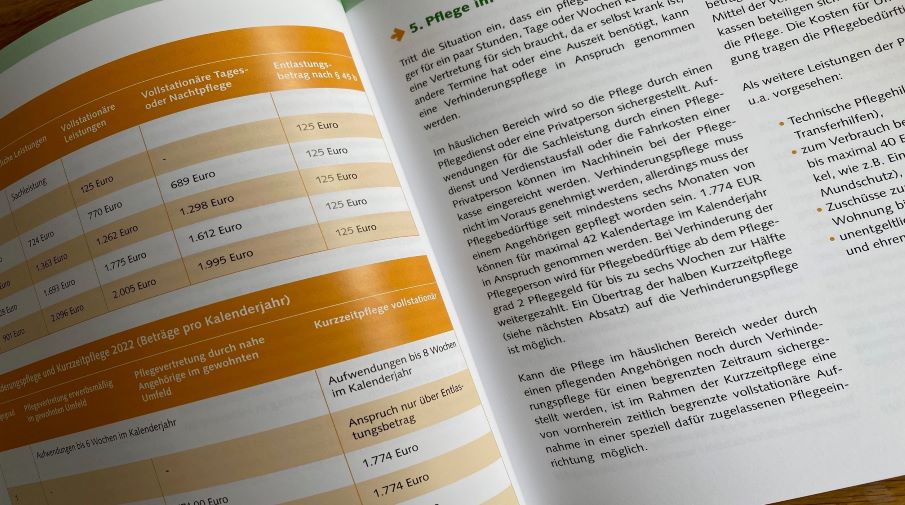 Unser Informationsangebot
Unser Informationsangebot - Angebote
- Forschung
- Über uns
- Spenden & Engagieren
Wenn ein Kind Krebs hat, dann betrifft das die ganze Familie. Die Diagnose ist erschütternd, die Ängste als Eltern kaum auszuhalten. Auch die kleinsten Geschwister spüren schnell, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Doch als Familie steht die Welt niemals still. Neben dem Schock, den es zu verarbeiten gibt und dem, was es rund um die Behandlung in die Wege zu leiten gibt, sind da oft noch Geschwister mit ihren Sorgen und Bedürfnissen und auch die Großeltern. Da ist noch der Haushalt, der sich nicht alleine erledigt und Jobs, die kein Geld einbringen, wenn man nicht hingeht. Das Umfeld stellt Fragen, der Kindergarten muss informiert, die Schule organisiert werden. Mit der Diagnose einer Krebserkrankung beginnt ein Lebensabschnitt voller Herausforderungen für alle Familienmitglieder. So ging es auch Familie H., die in einem Telefoninterview ihre Geschichte erzählt hat.
Familie H. war gerade auf Fahrradtour, als sie einen Anruf vom Kinderarzt erhielten. Sie sollen bitte sofort in die Klinik nach Würzburg kommen! In einer Routineuntersuchung waren einige Blutwerte des Sohnes auffällig. Sehr auffällig.
Fabian, damals 13 Jahre alt, hatte ansonsten keine Symptome, nichts, was die Familie argwöhnisch gemacht hätte. Doch die Diagnose war trotzdem so unfassbar, wie eindeutig: Akute myeloische Leukämie (AML).
Dass diese bösartige Erkrankung bei Fabian so früh erkannt wurde, war nicht nur ein großes Glück, sondern auch reiner Zufall. Offenbar hatte ein Laborant im Blut Auffälligkeiten entdeckt und schlichtweg genauer hingeschaut, als eigentlich vorgesehen.
An einem Mittwoch wurden Fabian und seine Eltern Heike und John über die Diagnose und die erforderliche Behandlung aufgeklärt. Am Samstag ging es direkt mit der Hochdosis-Chemotherapie los. In aller Kürze, mitten in der schlimmsten Krise ihres Lebens, musste sich die Familie an die neue Situation anpassen.

Fünf sogenannte Blöcke Chemotherapie, anschließend eine allogene Knochenmark-Transplantation. Alles in allem standen nun acht Monate Akuttherapiezeit vor ihnen, mit nur wenigen Wochen Pausen zwischen den Krankenhausaufenthalten, die der Jugendliche zu Hause bei seiner Familie verbringen durfte.
Zwei Drittel eines Jahres zwischen Klinik und zu Hause, zwischen Hoffen und Bangen um die Gesundheit des Jugendlichen. Und auch die Monate nach der Transplantation waren zunächst geprägt von mehreren wöchentlichen Kontroll-Terminen in der Kinderklinik. Erst mit fortschreitender Etablierung der Therapie konnte die engmaschige Begleitung reduziert werden.
Fabians Schwestern Felina und Finja waren zum Zeitpunkt seiner Diagnose sechs und elf Jahre alt. „Finja ist plötzlich, innerhalb von Tagen erwachsen geworden”, erinnern sich John und Heike. Schon am Tag der Diagnose hatte sie die Bedrohlichkeit der Situation sofort erkannt und alles um sich herum genauestens wahrgenommen.
Die Eltern mussten mit Fabian in die Klinik, beide wollten dies zusammen mit ihrem Ältesten durchstehen. Geschwister unter 14 Jahren durften allerdings nicht mit. Die Großeltern sollten zu diesem Zeitpunkt noch nicht informiert und in Aufruhr gebracht werden. Während die Eltern noch überlegten, war Finja sofort klar: „Fahrt ihr. Ich passe auf Felina auf. Ich schaffe das schon“.
Sichtlich gerührt und voller Stolz erinnern sich die beiden Eltern: „Finja und Felina haben uns Halt gegeben. In diesem Moment, aber auch oft danach.” Geschwister-Zwistigkeiten gab es plötzlich kaum mehr. Ihren Bruder haben sie in der Klinik in all der Zeit nur sehr wenige Male persönlich besuchen dürfen, nämlich wenn dieser aus der Quarantäne „Freigang“ im Klinikpark hatte.
Umso schöner war die gemeinsame Zeit zu Hause. Bei all ihrer Stärke und Kraft erinnert sich Finja aber auch mit ehrlichen Worten: „Manchmal habe ich mich schon ein wenig neidisch gefühlt, da sich alles um Fabian gedreht hat“. Richtig blöd war, dass Viele auch die Schwestern immer nur gefragt haben: „Wie geht es Fabian?“. Als würden Finja und Felina nur nebenher existieren. Eine Erfahrung, die die Eltern den beiden gerne erspart hätten. Sie wissen, dass auch die tapfersten Geschwister nicht nur Halt geben, sondern auch viel Halt brauchen in dieser Zeit. Von den Eltern, aber auch vom gesamten Umfeld.
Die Eltern pendelten von Beginn an. Die Klinik war nur ca. 30 Minuten Fahrtzeit von ihnen entfernt, sodass sie keine „Eltern“-Wohnung der sehr aktiven Eltern-Initiative in Anspruch nehmen mussten. Fabian blieb mit seinen 13 Jahren tapfer nachts allein im Krankenhaus und die Eltern schliefen in ihren eigenen Betten. Morgens wurden die Geschwister versorgt und in die Schule gebracht, John fuhr zur Arbeit, Heike in die Kinderklinik.
Gerade zu Beginn waren Heiko und John meistens beide in der Klinik. Später wechselten sie sich fast immer ab, damit immer einer bei Fabian sein konnte und einer zu Hause. Nach zwei bis drei Wochen hatten sie das Gefühl, in der Realität angekommen zu sein. Damals. Jetzt, zurückblickend wissen sie – sie waren auch zu diesem Zeitpunkt noch völlig in einem Tunnel.
„Man steckt drin und sieht das Ende nicht“, erinnern sie sich. Irgendwann wurde der neue Tagesablauf und die Behandlung zwar mehr und mehr zur Routine, aber die Bedrohlichkeit blieb. Durch die aggressive Behandlung wurden zwar die Krebszellen Schritt für Schritt zerstört, doch die Nebenwirkungen waren immens und kräftezehrend – für Fabian und auch für seine Eltern, die ihr Kind leiden sahen und durch alle Höhen und Tiefen begleiteten.
John ist seinem Arbeitgeber sehr dankbar. Er stieß auf großes Verständnis, Flexibilität und Entgegenkommen im gesamten Team, das für ihn einsprang, wann immer es erforderlich war. Durch Krankmeldungen, Urlaubstage und Überstundenabbau schaufelte er sich notfalls ganz frei und wusste, dass er auf seine Kollegen zählen konnte. Heike wollte eigentlich zum Zeitpunkt der Diagnose gerade einen neuen Job beginnen. Doch dies schob sie auf, damit sie allen Anforderungen rund um die Kinder, den normalen und neuen Alltag gerecht werden konnte. Entlastend für alle war, dass beide Großeltern und Verwandte in der Nähe wohnten. So wusste Familie H. um die glückliche Lage, dass sie notfalls auf eine wichtige Hilfe zurückgreifen konnten, wenn alle Stricke reißen sollten.
Einigen Familien hilft es, wenn sie im Haushalt und Alltag unterstützt werden. Für Heike war es anders. „Mein Haushalt war für mich ein kleines Stück Normalität, die ich mir bewahren wollte. Das wollte ich nicht auch noch abgeben, wie meinen Sohn in die Klinik“. Auch hier war es aber gut zu wissen, dass mit den Omas oder Schwägerinnen sowie Freunden, die dies immer wieder anboten, notfalls ein Hilfesystem dagewesen wäre. Aber die Familie hütete sich ihr eigenes System so gut es ging.
Besonders geholfen hat in dieser Zeit das gesamte Team in der Klinik – die Pfleger, die Schwestern, die Ärzte, das psychosoziale Team und der Elternverein vor Ort. Hier erlebte die Familie eine große Unterstützung. Besonders wertvoll war für sie in all der Zeit auch, wenn sie aufrichtiges Interesse ihrer Nachbarn, von Freunden und Bekannten erfuhren, wenn sie überraschende Gesten erlebten, auch von Mitmenschen, die ihnen eigentlich gar nicht so nahestanden.
Da war der Schulleiter von Fabian, der sie als ganze Familie verlässlich durch die Zeit begleitete, der damalige Klassenlehrer und die Theaterlehrerin, die bis heute Kontakt halten, die Nachbarn und Bekannten, die geweihte christliche Symbole zum Schutz von der Wallfahrt mitbrachten, oder eine entferntere Nachbarin, die in einer Karte mit Schutzengel gute Wünsche schickte.
Überraschende Momente, die Kraft gaben und zeigten, dass Jemand ehrlich Anteil nahm. Dies half auch ein wenig darüber hinweg, dass sie von so manch anderen Freunden eher enttäuscht wurden. „Am Anfang melden sich die Leute noch. Da fehlt aber die Kraft für die Antwort“, erinnern sich Heike und John. Allen Lesern, die Familien in einer solchen Situation kennen, raten sie, gerade zu Beginn keine Antworten zu erwarten. „Wir hatten ja selbst keine!“. Wenn man sich in dieser Zeit nicht zurückmeldet, heißt das, dass man gerade nicht antworten kann, aber nicht, dass man nicht antworten will: „Habt Geduld mit den betroffenen Familien, vergesst sie nicht und bleibt dran.“ Neben Textnachrichten schicken auch einfach mal anrufen oder vorbeifahren, empfehlen die beiden zurückblickend.
Heike und John wurde schnell klar, dass sie das Informationsbedürfnis des Umfelds nicht „einzeln“ bedienen konnten, auch wenn sie es gerne gewollt hätten. Es war für sie schlicht ermüdend, jedem immer das Gleiche zu erzählen. Sie hatten nicht die Kraft und sie verloren den Überblick, wem sie eigentlich was schon erzählt hatten.
Sie hatten ohnehin früh begonnen Tagebuch zu schreiben, in dem sie die Therapie, all ihre Erlebnisse, Gedanken und Gefühle loswerden und sortieren konnten. Der enge Kreis, der ehrlich interessiert am Verlauf der Dinge war, wurde nun eingeladen, in einem anonymisierten Blog mitzulesen. Die beiden Eltern erstellten kurzerhand eine Verteiler-Gruppe mit 40-50 Personen, über die sie in regelmäßigen Abständen von Fabian und ihnen als Familie berichteten.
Am Ende standen da 250 Seiten ungeschönter nackter Wahrheit. Nicht um eine Reaktion zu erhalten. Aber der Blog gab die Möglichkeiten, gezielte Fragen zu dem Geschriebenem zu stellen und so teilzuhaben. Und er ist auch Selbst-Therapie – bis heute. Die Rückmeldungen zeigten, dass diese ganz persönlichen Einblicke dabei sehr halfen, die Situation der Familie besser zu verstehen und die Sprachlosigkeit, die sie im Umfeld oft auslöst, zu überwinden.
Heute, gut 1,5 Jahre nach der Behandlung geht es Fabian gut. Nach Ende der stationären Therapie musste er noch einige Monate Immunsuppressiva nehmen und die ganze Familie musste zu seinem Schutz vor Infektionen strenge Hygienevorkehrungen einhalten. Mitten in diese Zeit, als sich Fabians Immunsystem endlich weitestgehend stabilisieren und die Medikamente sich reduzieren sollten, kam jedoch der nächste Dämpfer: Corona. Für Fabian ein harter Schlag.
Nun wurde er erneut – dieses Mal durch die Pandemie – ausgebremst: „Ich habe das alles doch nicht durchgestanden, um dann an diesem Virus zu sterben!“, ängstigte er sich verständlicherweise sehr. Die 8. Klasse hatte er noch in der Therapiezeit abgeschlossen. Die 9. Klasse besuchte er zunächst während der Therapie, teils mit Klinikunterricht, teils durch täglich wechselnde Fachlehrer im Hausunterricht. Durch Corona wurde der Anschluss an die Lehrinhalte jedoch weiter erschwert.
Fabian wiederholt nun doch die 9. Klasse – mit weniger Druck, die Dinge aufholen zu müssen. Dies zu akzeptieren ist ihm nicht leichtgefallen. Seine Freunde und die alte Klasse fehlten ihm doch sehr. Viele haben sich während seiner Behandlungszeit zurückgezogen, was er bis heute nicht ganz verstehen kann. Das macht ihn sehr traurig, vor allem, weil er einfach gerne verstehen würde, warum? Wieso melden sich seine engeren Freunde von jetzt auf gleich nicht mehr? Was geht wohl in denen vor?
Fabian versucht optimistisch in die Zukunft zu schauen, und es tut ihm gut, zu merken, dass seine neue Klasse ihn gut aufnimmt, seine Lehrer ihn sehr unterstützen. Er wünscht sich nichts mehr, als endlich wieder „ganz normal“ richtig zurück ins Leben kehren zu können. Mit allem Drum und Dran.
Dabei begleitet ihn auch eine ganz besondere Vorfreude: Bald darf er seinem Spender persönlich begegnen, der ihm mit einer Knochenmarkspende das Leben gerettet hat. Von Beginn an gab es einen regen Briefkontakt zu ihm. Nicht nur Fabian, auch seine Schwester Finja tauscht sich in Briefen gerne mit ihm aus. Post, die bisher noch von der Klinik zum Schutz des Spenders geprüft und anonymisiert wird.
Die ganze Familie fiebert dem Moment entgegen, nach Ende dieser Schutzzeit dem jungen Mann in die Augen schauen zu dürfen, der ihnen das allergrößte Geschenk auf Erden gemacht hat. Irgendwann möchte Familie H. auch noch dem Laboranten danken, der so gründlich hingeschaut hat, dass Fabians schwere Krebserkrankung erkannt wurde, noch ehe sich Symptome zeigten.
Adenauerallee 134
53113 Bonn
Tel.: 02 28 / 68 84 6 – 0
Fax: 02 28 / 68 84 6 – 44
Deutsche Kinderkrebsstiftung
DE 04 3708 0040 0055 5666 16
DRESDEFF370
Commerzbank
USt.-IdNr.: DE 223 47 16 38
Die Deutsche Kinderkrebsstiftung ist wegen der Förderung mildtätiger Zwecke, von Wissenschaft und Forschung, der Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege sowie des bürgerschaftlichen Engagements von der Körperschaftsteuer befreit (Ust.-IdNr.: DE 223 47 16 38), Finanzamt Bonn Innenstadt.